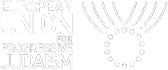Va’eira – Deutsch
Wieder sehen lernen, was wir nicht mehr sehen
Rabbiner Akiva Weingarten (Übersetzung Rabbinerin Lea Mühlstein)
Paraschat Va’era beginnt mit einer eindringlichen göttlichen Aussage:
„Ich bin Abraham, Isaak und Jakob als El Schaddai erschienen, aber mit meinem Namen J-H-W-H habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben.“ (Ex 6,3)
Offenbarung ist in diesem Vers kein einzelner Moment, sondern ein sich erweiternder Kreis. Die Erzväter kannten etwas von Gott; Israel in Ägypten wird eingeladen, etwas Tieferes zu erkennen; am Sinai wird sich dieses Wissen erneut ausweiten. Judentum, mit anderen Worten, wächst durch immer neue, sich entfaltende Schichten des Sehens.
Doch Va’era konfrontiert uns unmittelbar mit der entgegengesetzten Dynamik: mit den Wegen, auf denen wir unfähig werden zu sehen.
„Aber sie hörten nicht auf Mose, wegen der Kurzatmigkeit und der harten Arbeit.“ (Ex 6,9)
Die Tora benennt hier eine spirituelle Wahrheit, die jüdischen Gemeinschaften in ganz Europa schmerzhaft vertraut ist: Menschen, die unter Druck leben – wirtschaftlichem Druck, politischer Unsicherheit, der Angst vor Anfeindungen oder Antisemitismus – hören selbst die Worte nicht mehr, die sie befreien sollen. Trauma zieht die innere Welt zusammen. Der Blick verengt sich.
Die doppelte Krise: Pharaos verhärtetes Herz und Israels gebrochener Geist
Ein Großteil von Va’era kreist um das verhärtete Herz des Pharao. Siebenmal wird in diesem Abschnitt sein Herz verhärtet – manchmal durch Gott, manchmal durch ihn selbst und manchmal durch die träge Eigendynamik der Macht.
Doch die Parascha zeigt auch: Israels Herz ist gebrochen. Pharaos Weigerung, das Volk ziehen zu lassen, spiegelt sich in ihrer Unfähigkeit, daran zu glauben, dass Freiheit überhaupt möglich sein könnte.
Der Baal Schem Tow lehrte, dass der Yetzer Hara einen Menschen oft in Atzvut, in Niedergeschlagenheit, führt, indem er ihm einredet, er habe gesündigt – und dass der Mensch dann nicht mehr an die Möglichkeit von Veränderung glaubt. Diese Dynamik sehe ich heute in jüdischen Gemeinschaften in ganz Europa: kleine Gemeinschaften, müde von Jahrzehnten des Wiederaufbaus, konfrontiert mit Antisemitismus, der unerwartet aufflammt, oder mit demografischem Rückgang. Die Gefahr liegt nicht nur in der Feindseligkeit der „Pharaonen“ dieser Welt, sondern auch in der inneren Erschöpfung, die uns vergessen lässt, wer wir eigentlich sein sollen.
Doch Gott erscheint erneut – „Va’era“ – genau dort
Vor diesem Hintergrund sagt Gott: „Va’era, ich bin erschienen.“
Offenbarung geschieht nicht dann, wenn Israel spirituell vorbereitet ist, sondern gerade dann, wenn es am meisten niedergebeugt ist. Gott begegnet ihnen in ihrem eingeschränkten Sehen.
Dies ist vielleicht das Radikalste an dieser Parascha:
Der Gott, den die Erzväter nur teilweise kannten, wird einer Generation voll gegenwärtig, die kaum noch Luft zum Atmen hat.
Offenbarung ist somit keine Belohnung für spirituelle Leistung.
Sie ist ein Akt göttlicher Solidarität.
Daran denke ich oft, wenn ich kleine europäische Gemeinden besuche: ein Minjan, der sich an einem Freitagabend gerade so zusammenfindet; eine Gemeinschaft von fünf Bar- und Bat-Mitzwa-Schüler*innen, verteilt über eine ganze Region. Und doch erscheint in diesen bescheidenen Räumen etwas von „Va’era“: eine Gegenwart, die nicht von Größe oder Pracht abhängt.
Die Plagen: Unterbrechung als Offenbarung
Die zehn Plagen beginnen in Va’era, und so verstörend ihre Gewalt ist, tragen sie doch ein theologisches Motiv in sich: Die Wirklichkeit muss unterbrochen werden, damit neues Sehen möglich wird.
Als sich der Nil in Blut verwandelt, sagt die Tora:
„Die Ägypter konnten kein Wasser aus dem Nil trinken.“ (Ex 7,21)
Das ist nicht nur Strafe, sondern Unterbrechung. Ein System, in dem Unterdrückung zur Normalität geworden ist, muss zunächst aus der Normalität gerissen werden. Störung erzwingt Wahrnehmung.
In unserem Kontext lese ich die Plagen als Metaphern für Momente, die Gesellschaften aus ihrer Selbstzufriedenheit aufschrecken. Zunehmender Antisemitismus, öffentliche Debatten über Identität, Flüchtlingskrisen, Polarisierung – keine dieser „Plagen“ ist willkommen, doch sie legen Wahrheiten offen, die zuvor ignoriert wurden. Sie zwingen Europa, sich den Grenzen seiner liberalen Versprechen zu stellen.
Die Frage ist nicht, ob Unterbrechung kommt, sondern ob wir sie wie der Pharao deuten – indem wir uns weiter verhärten – oder wie Israel es schließlich tat: indem wir Störungen als Einladungen zur Veränderung verstehen.
Die Gefahr der Vertrautheit: Mose und Aaron vor dem Pharao
Ein oft übersehenes Detail ist die Dynamik zwischen Mose und Aaron. Als Aaron seinen Stab niederwirft und dieser sich in eine Schlange verwandelt, ahmen die ägyptischen Zauberer das Kunststück nach. Doch dann heißt es:
„Aarons Stab verschlang ihre Stäbe.“ (Ex 7,12)
Eine midraschische Deutung liest diesen Vers so: Der Stab kehrt zuerst wieder zu einem Stab zurück, bevor er die anderen verschlingt. Mit anderen Worten: Befreiung braucht kein Spektakel; sie braucht Authentizität. Die jüdische Zukunft wird nicht dadurch gesichert, dass wir andere übertreffen, sondern dadurch, dass wir tiefer wir selbst sind.
Gerade im europäischen Kontext ist das eine zentrale Botschaft. Jüdische Gemeinschaften stehen oft unter dem Druck, ihre Existenz zu „rechtfertigen“, sich kulturell, politisch oder ästhetisch zu erklären – als wäre Assimilation der Preis für Akzeptanz. Va’era lehrt jedoch: Erlösung geschieht, wenn wir zu unserer authentischen Gestalt zurückfinden und – sanft, aber selbstbewusst – die Erzählungen verschlingen, die uns kleinmachen wollen.
Eine europäische Lesart: Wieder lernen, einander zu sehen
Das übergreifende Thema von Va’era ist die Wiederherstellung des Sehens: Gott zeigt sich, Israel lernt erneut, Hoffnung wahrzunehmen, der Pharao weigert sich, die Menschlichkeit derer zu sehen, die er versklavt.
Europa ringt heute mit einer eigenen Krise des Sehens. Polarisierung schafft Echokammern; Angst verzerrt Wahrnehmung; Gemeinschaften reden aneinander vorbei. Jüdische Gemeinschaften fühlen sich beobachtet, aber nicht gesehen – präsent, aber nicht verstanden.
Paraschat Va’era fordert uns heraus:
Wo spirituelle oder soziale Unterdrückung das Hören unmöglich macht, muss jemand erneut sprechen. Und wo Herzen verhärtet sind, muss jemand zuerst weich werden.
Mose ist hier ein Vorbild. Trotz wiederholten Scheiterns kehrt er zum Pharao zurück. Trotz der Unfähigkeit Israels zuzuhören, spricht er weiter. Beharrlichkeit – nicht Perfektion – ist es, was Geschichte bewegt.
Schluss: Sich für das Sehen entscheiden
Va’era lädt uns ein, eine langsame, eigensinnige Form des Sehens zu kultivieren – eine, die Möglichkeiten erkennt, selbst wenn der Moment hoffnungslos erscheint. Für jüdisches Leben in Europa bedeutet das, weiter aufzubauen, zu lehren, einzuladen und jüdische Räume zu gestalten – mit Selbstvertrauen, auch wenn Gemeinden klein sind oder sich überfordert fühlen.
Offenbarung ist kein Geschenk der Vergangenheit; sie ist eine Praxis der Gegenwart.
Wie Gott zu Beginn unserer Parascha sagt:
„Va’era – ich bin erschienen.“
Mögen wir lernen, wahrzunehmen, was uns erscheint, und möge unser erneuertes Sehen uns helfen, persönlich wie kollektiv, von Enge zu Freiheit zu gelangen.
Rabbiner Akiva Weingarten ist Rabbiner der Stadt Dresden. Zuvor wirkte er in der liberalen Gemeinde Migwan in Basel (Schweiz). Er ist Gründer der Haichal-Besht-Synagoge in Bnei Brak (Israel), der Haichal-Besht-Synagoge in Berlin sowie der Besht-Jeschiwa in Dresden.