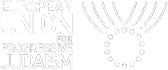Lech L’cha – Deutsch
Den Bund weitertragen
Rabbinerin Lea Mühlstein (Korrektur Dr. Jan Mühlstein)
„Der Ewige hatte aber zu Awram gesprochen: ‚Ziehe hinweg aus deinem Land, von deinem Geburtsort und von deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen, will dich segnen und deinen Namen groß werden lassen. Du selbst sollst ein Segen sein.‘“ (1. Buch Mose 12:1–2, nach der Übersetzung von Moses Mendelssohn)
Parashat Lech Lecha beginnt mit einem kühnen Ruf: Gott befiehlt Awram, seine Heimat, seine Familie und das Haus seines Vaters zu verlassen, um in das Unbekannte aufzubrechen. Aber warum sendet Gott Awram auf diese Reise? – Um die Verheißung in neue Länder zu tragen.
Nach Bereschit Rabba 38:13, einem bekannten Midrasch, beginnt Awrams Reise mit einem Akt des Widerstands gegen die Normen seines Vaters Terach. Als er in dessen Götzenladen zurückgelassen wird, zerbricht Awram alle Statuen. Für diese Auflehnung muss er fliehen – mit nichts als Gottes Verheißung im Gepäck, auf dem Weg in ein unbekanntes Land.
Die schottisch-israelische Tora-Gelehrte Avivah Gottlieb Zornberg bemerkt, dass der Befehl „lech lecha“ – wörtlich „geh zu dir selbst“ – nicht nur ein Ruf ist, das Zuhause zu verlassen, sondern auch ein Aufruf, die eigene Identität zu riskieren. Voranzugehen bedeutet, etwas Neues zu werden. Diese Einsicht verbindet die biblische Erzählung mit der späteren jüdischen Erfahrung: Den Bund weiterzutragen heißt oft, sich selbst, Sicherheit und Gewissheit aufs Spiel zu setzen, um jüdisches Leben zu erneuern.
Viele Generationen nach Awram wurde ein anderer Jude gezwungen, seine Heimat zu verlassen, weil er sich gegen die Normen seiner Zeit auflehnte. Isaac Mayer Wise (1819 – 1900) ist wohl am bekanntesten als Gründer der Union of American Hebrew Congregations (heute URJ, 1873), des Hebrew Union College (1875) und der Central Conference of American Rabbis (1889). Doch seine eigene lech lecha-Geschichte ist weniger bekannt.
Im Böhmen des 19. Jahrhunderts schränkten die sogenannten Familianten-Gesetze ein, wie viele Juden pro Jahr heiraten durften – viele wurden so zur Ehelosigkeit oder zur Emigration gezwungen. Der Rabbiner Isaac Weiss, wie er damals hieß, diente der Gemeinde von Radnice, wo er trotz des Verbots jüdische Paare traute, und wurde dafür verfolgt. 1846 floh er in Verkleidung auf einem Bauernwagen und emigrierte mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten. Wie Awram weigerte sich Wise, die Normen seiner Zeit zu akzeptieren. Er zog aus den böhmischen Ländern ins Unbekannte, trug den Bund mit sich und pflanzte ihn jenseits des Ozeans neu – brachte die Ideen des europäischen Reformjudentums mit, die auf amerikanischem Boden Wurzeln schlugen und aufblühten.
Rabbiner Wises Geschichte der Verfolgung kündigte das dunkelste Kapitel der tschechisch-jüdischen Geschichte an. Die Shoah zerstörte eine einst blühende Gemeinschaft. Als die tschechischen Juden erkannten, in welcher Gefahr sie sich befanden, sammelten sie die Tora-Rollen des Landes im Jüdischen Museum in Prag, in der Hoffnung, sie könnten bewahrt werden. Während viele tschechische Juden – auch die Kuratoren des Museums – nicht aus den Lagern zurückkehrten, überlebten mehr als 1.500 Rollen.
Nach dem Krieg, als die Rollen wiederentdeckt wurden, trat ein von der kommunistischen Regierung geführtes Unternehmen an einen Londoner Kunsthändler heran, der regelmäßig nach Prag reiste, um Gemälde zu kaufen, und fragte, ob er Interesse an den Torarollen habe. Dieser wandte sich an Ralph Yablon, der sich mit Rabbiner Harold Reinhart von der Westminster Synagogue beriet und schließlich die gesamte Sammlung erwarb. Der Czech Memorial Scrolls Trust wurde in London gegründet, um die Rollen zu restaurieren und sie an Gemeinden auf der ganzen Welt zu vergeben. Heute sind Hunderte von URJ-Gemeinden in Nordamerika und darüber hinaus Hüter dieser Rollen. Jede einzelne ist ein Überlebender – ein Fragment des weiter getragenen Bundes, das verkündet, dass die Tora auch nach der Verwüstung weiter spricht. Wenn Reformjuden in Chicago, Toronto oder London eine tschechische Rolle aufrollen, knüpfen sie Verbindung zu den Städten und Stimmen des tschechischen Judentums.
Eine dieser Rollen inspirierte Rabbiner Dr. Andrew Goldstein von The Ark Synagogue in London, Kontakt zu den wenigen verbliebenen Juden im Nachkriegs-Tschechien aufzunehmen. Nach dem Fall des Kommunismus 1989 arbeitete er mit lokalen Führern und der European Union for Progressive Judaism zusammen, um Gemeinden in Prag und darüber hinaus wiederaufzubauen – damit progressives jüdisches Leben erneut auf tschechischem Boden Wurzeln schlagen konnte. Seine und seines Teams Forschungen über die „tschechischen Tora-Städte“ gaben den Gemeinschaften, aus denen die Rollen stammten, eine Stimme und schufen bleibende Verbindungen zwischen tschechischen Juden und Reformjuden weltweit. Heute wächst die tschechische progressive Gemeinschaft in Stärke und Selbstbewusstsein und ist stolz darauf, von einem in Tschechien geborenen Rabbiner, David Maxa, geleitet zu werden – ein Zeichen dafür, dass der einst ins Ausland getragene Bund nun wieder zuhause gepflanzt und lebendig ist.
Von Awrams Aufbruch ins Unbekannte über Isaac Mayer Wises Flucht aus Radnice, von den Tora-Rollen, die aus tschechischen Städten zu Reformgemeinden in aller Welt wanderten, bis hin zur Wiedergeburt des progressiven Judentums in Böhmen – die Geschichte von Gottes Verheißung war nie an einen Ort gebunden. Sie wird durch Mut, Widerstandskraft und Glauben weitergetragen.
Zornberg erinnert uns daran, dass Parashat Lech Lecha nicht nur vom Verlassen des Hauses spricht, sondern auch vom Wagnis, die eigene Identität zu riskieren, um den Bund in neue Zukünfte zu tragen. Parashat Lech Lecha fordert uns auf zu fragen, welche Normen unserer Zeit wir akzeptieren, obwohl sie vielleicht unserer heiligen Tradition widersprechen. Sie ruft uns zugleich auf, den Mut zum Aufbruch zu finden: zu wagen, zu handeln und den Bund weiterzutragen, damit er in unserer eigenen Zeit lebendig bleibt.