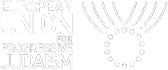Tol’dot – Deutsch
Wenn es so ist – warum bin ich dies? Der Mut, in Vielstimmigkeit zu leben
Rabbinerin Lea Mühlstein (Korrektur Dr. Jan Mühlstein)
„Aber die Kinder stießen sich heftig in ihrem Leibe, dass sie sprach: Wenn es so ist, warum bin ich dies? Und sie ging, den Ewigen zu befragen. Da sprach der Ewige zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leib, zwei Stämme scheiden sich aus deinem Schoß, Stamm mächtiger als Stamm, der ältere wird dem jüngeren dienen.“ (Gen 25,22–23, nach der Übersetzung von Ludwig Philippson)
Rebekkas Frage durchdringt den Text: „Wenn es so ist – warum bin ich dies?“ Ihr Körper wird zum Ort göttlicher Widersprüche. Zwei Nationen wohnen in ihr, zwei Zukünfte ringen in ihrem Bauch. Das Bild der Tora wird oft als Prophezeiung unvermeidlicher Konflikte gelesen – doch es lässt sich auch, wie die feministische jüdische Theologin Judith Plaskow lehrt, als Offenbarung der Vielheit lesen.
In ihrem Essay Jewish Theology in Feminist Perspective schreibt Judith Plaskow, feministische Theologie sei „verwurzelt in der Erfahrung einer umfassenderen und reicheren Weise des Seins, die sie innerhalb und zugleich gegen die Begriffe der Tradition zum Ausdruck bringen will.“ In ihrem Werk betont Plaskow immer wieder, dass Offenbarung kein abgeschlossenes Gut sei, sondern ein fortwährendes, gemeinschaftliches Werk – eines, das wächst, indem es zuvor zum Schweigen gebrachte Stimmen integriert und kreative Spannungen aushält. Rebekkas Aufruhr wird so nicht zum Fluch, sondern zur Berufung. In ihr koexistieren widersprüchliche Wahrheiten; sie verkörpert einen Bund, der Spannung in sich trägt.
In diesem Licht gesehen, ist Rebekkas Schwangerschaft ein theologisches Gleichnis für das jüdische Dasein in Gesellschaften, die ungeteilte Loyalität verlangen. Ihre Frage „Wenn es so ist – warum bin ich dies?“ ist der Schrei jeder Gemeinschaft, die zwischen Glaube und Nation, zwischen Tradition und Moderne gefangen ist.
Nirgends wurde dieser innere Konflikt schärfer als in Frankreich – der Wiege der jüdischen Emanzipation und später der institutionalisierten Anpassung. Als Napoleon 1807 das Grand Sanhedrin einberief, wollte er die Juden als loyale französische Bürger integrieren und sie zugleich zwingen, ihren Glauben im Rahmen der staatlichen Logik neu zu definieren. Der Sanhedrin hatte zwölf Fragen zu beantworten, um zu beweisen, dass das Judentum mit dem Code Napoléon vereinbar sei: Würden Juden Nichtjuden heiraten? Das Zivilrecht über die Halacha stellen? In der Armee dienen?
Auch wenn Napoleons Fragen nicht alle in gutem Glauben gestellt waren, nahm die jüdische Gemeinschaft sein Projekt bereitwillig an – den Versuch, zwei Nationen in einem Körper zu vereinen: die Französische Republik und das jüdische Volk. Doch diese Integration hatte ihren Preis: den Verlust religiöser Autonomie. Aus diesem Prozess ging das Konsistorialsystem hervor, eine zentralisierte Struktur, die das jüdische Religionsleben unter staatliche Aufsicht stellte.
Ein Jahrhundert später stellte sich Rabbiner Louis Germain Lévy (1866–1946), einer der Gründer der Union Libérale Israélite de Paris (ULIP) im Jahr 1907, diesem Erbe. Als angesehener Gelehrter und Rabbiner der Rue-Copernic-Synagoge suchte Lévy nach einem Weg, sowohl französische Identität als auch jüdische spirituelle Unabhängigkeit zu bejahen. Er umarmte den Universalismus der Republik, widersetzte sich jedoch dem Monopol des Konsistoriums. Wie Rebekkas Zwillinge kämpften auch diese beiden Impulse in einem Körper miteinander.
Lévys Predigten und Schriften zeigen seinen Versuch, das Judentum als moralischen und rationalen Glauben zu interpretieren – im Einklang mit den republikanischen Werten Frankreichs, aber nicht in ihnen aufgehend. Er glaubte, dass die Lebendigkeit des Judentums Freiheit des Denkens und Reform der Rituale benötige. Die Union Libérale bot ein Zuhause für jene, die sich im Geiste französisch fühlten und zugleich nach einem Judentum suchten, das offen war für Moderne, Gleichheit und intellektuelle Aufrichtigkeit. In diesem Sinne verwirklichte Lévy Plaskows Vision von Offenbarung als Dialog: Tradition, die in der Sprache ihrer Zeit neu spricht.
Doch wie in Rebekkas Leib blieb auch das Verhältnis der beiden „Nationen“ gespannt. Das Konsistorium warf den Liberalen Juden Verrat vor, während diese das Konsistorium der Erstarrung beschuldigten. Beide beanspruchten, das wahre Erbe zu tragen. In Frankreich wie in der Genesis ging es nicht nur darum, wer herrschen sollte, sondern darum, ob beide nebeneinander existieren konnten, ohne einander zu vernichten.
Plaskows Theologie lädt uns ein, dies nicht als Tragödie der Spaltung zu lesen, sondern als Zeichen des Lebens. Ein Glaube, der gegensätzliche Wahrheiten aushalten kann, ist ein lebendiger Glaube. Die Geschichte des französischen Judentums, wie Rebekkas eigene, erzählt nicht vom Sieg des einen über den anderen, sondern davon, dass sowohl bürgerliche als auch Pflichten der Treue zum Bund innerhalb einer Identität fortbestehen können.
Heute stehen die liberalen jüdischen Gemeinden Frankreichs – organisiert in Judaïsme En Mouvement und La Fédération du Judaïsme Libéral – als Brücke zwischen Tradition und Moderne, zwischen jüdischer Eigenständigkeit und universeller Ethik. Ihr Engagement für Geschlechtergerechtigkeit, interreligiösen Dialog und republikanische Werte verkörpert eine Identität, die sich der Eindeutigkeit verweigert.
Die Geschichte von Toldot lädt uns ein zu fragen, wie wir mit den Spannungen umgehen, die in uns leben. Sehen wir sie als Bedrohung der Einheit – oder als Zeichen eines lebendigen Bundes? In Rebekkas Ringen und in Frankreichs Aushandlung zwischen Glauben und Bürgerschaft erkennen wir: Widerspruch ist kein Makel, sondern eine Bedingung für Lebendigkeit.
Als liberale Jüdinnen und Juden zu leben heißt, diese Komplexität zu bejahen – zu wissen, dass Glaube, Identität und Zugehörigkeit immer in mehr als eine Richtung ziehen. Unsere Aufgabe ist es nicht, diese Spannungen aufzulösen, sondern sie mit Integrität zu eigen machen. Wie Rebekka und die Pionierinnen und Pioniere des französischen liberalen Judentums bekennen wir: Der göttliche Segen liegt im Mut, in der Vielheit wahrhaftig zu leben.