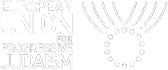Vayeira – Deutsch
Sarahs Stimme hören
Rabbinerin Lea Mühlstein (Korrektur Dr. Jan Mühlstein)
„Denn ich erkannte ihn, weil er befehlen wird seinen Kindern und seinem Haus nach ihm, dass sie halten den Weg des Ewigen , zu tun Gerechtigkeit und Recht (tzedakah u’mishpat) `{`…`}`. … Und es war `{`...`}`, da versuchte Gott den Awraham `{`…`}`.“ (Gen 18,19; 22,1, nach der Übersetzung von Ludwig Philippson)
Traditionell wird Paraschat Wajeira durch die Augen von Abrahams Glauben gelesen: seine Gastfreundschaft gegenüber Fremden, sein Flehen für Sodom, seine Bindung Isaaks. Aber was wäre, wenn wir Sarah in das Zentrum dieser Erzählung stellten?
In Dirshuni: Contemporary Women’s Midrash stellt sich Rivkah Lubitch die Akedah als eine Prüfung Sarahs vor. Ein Engel befiehlt ihr: „Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, und bringe ihn als Opfer dar.“ Sarah weigert sich: „Nein. Denn eine Mutter schlachtet ihr Kind nicht.“ Als sie erwacht, sind Abraham und Isaak fort, und sie betet: „Ich weiß, dass der, der seinen Sohn im Namen Gottes schlachtet, am Ende ohne Sohn und ohne Gott bleiben wird. Vergib Abraham, der sich hierin geirrt hat. Bitte erinnere Dich, dass es einer Mutter nicht in den Sinn kam, ihren Sohn Gott zu opfern – und rette den Jungen vor ihm.“
Lubitchs Sarah deutet den Bund neu: nicht als blinden Gehorsam, sondern als Weigerung, einem ungerechten Befehl zu folgen – selbst wenn er im Namen Gottes ergeht. Ihr Widerstand wird zum wahren Akt von tzedakah u’mishpat, von Gerechtigkeit und Recht.
Diese Neuinterpretation klingt an in der ungarischen Geschichte jüdischer Moderne. Im 19. Jahrhundert wurde Budapest zu einem Zentrum des Reformjudentums. Lipót Löw (1811–1875), ein bahnbrechender Rabbiner und Gelehrter, predigte auf Ungarisch, setzte sich für die vollen Bürgerrechte der Juden ein und gestaltete das Synagogenleben neu – mit Predigten in der Landessprache, moderner Architektur und sogar Orgelmusik. Sein Einfluss zeigt sich noch heute in der Großen Synagoge in der Dohány utca (Tabakgasse) in Budapest, die das Vorbild für die Central Synagogue in Manhattan war. Wie Sarah widersetzte sich Löw der Vorstellung, dass Bundestreue Unterwerfung bedeute. Er bestand darauf, dass die Zukunft des Judentums von ethischer Erneuerung, Bildung und Integration in die ungarische Kultur abhänge.
Doch die Geschichte unterbrach diesen Weg. Die Schoa verwüstete das ungarische Judentum, und der Kommunismus brachte religiöses Leben zum Schweigen. In vielen westeuropäischen Städten nach der Schoa bauten überlebende orthodoxe Juden das Gemeindeleben wieder auf, was das religiöse Zentrum in Richtung Tradition verschob. In Ungarn war es anders: Weil Religion selbst unterdrückt wurde, erstarrte die dortige progressive Bewegung – das Neologe Judentum – in ihrer Vorkriegsform. Anstatt sich weiterzuentwickeln, wie Löw es beabsichtigt hatte, wurde sie zur Hüterin eines überholten Zustands. Heute ist das Neologe Judentum der konservativen Bewegung angeschlossen und folgt einer traditionelleren Praxis, als Löw sie sich wohl vorgestellt hätte.
Und doch – so wie Sarahs Stimme erklingt, um Abrahams fehlgeleiteten Eifer zu korrigieren, so haben sich seit dem Ende des Kommunismus 1989 in Ungarn progressive Gemeinden gebildet – kleine, aber entschlossene Gemeinschaften wie Sim Shalom und Bét Orim in Budapest. Sie führen Löws wahres Erbe fort: Sie leben Inklusivität, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit. Sie lehnen die Vorstellung ab, Judentum könne durch bloße Wiederholung des Vergangenen bewahrt werden. Stattdessen bestehen sie darauf, dass der Bund lebendig, dynamisch und ethisch ist – erneuert durch Pluralismus und Offenheit.
So betrachtet sind die progressiven Jüdinnen und Juden Ungarns Sarahs Erben. Wie sie lehnen sie eine Deutung des Bundes ab, die Opfer heiligt oder Tradition erstarren lässt. Sie verkünden stattdessen, dass Gottes Weg der Weg der Gerechtigkeit ist, dass die Aufgabe des Judentums Erneuerung ist und dass Gehorsam ohne Ethik kein Bund ist.
Genesis 18,19 lehrt, dass Abraham auserwählt wurde, um seine Kinder in tzedakah u’mishpat zu unterweisen. Rivkah Lubitchs Midrasch erinnert uns daran, dass Sarahs Weigerung – und ihre ethische Klarheit – Isaaks Zukunft sichert. In Ungarn ist es die Beharrlichkeit der progressiven Gemeinden auf Gerechtigkeit und Inklusivität, die den Bund heute erneuert.
Kinder Abrahams und Sarahs zu sein bedeutet, nicht die Lebenden auf dem Altar eines fehlgeleiteten Glaubens zu opfern, sondern den Bund von Gerechtigkeit und Recht zu verkörpern. Das ungarische progressive Judentum bezeugt, dass selbst dann, wenn die Geschichte die Tradition einfriert, Erneuerung möglich bleibt.
Und was ist mit uns? Was würde es für unser Leben bedeuten, auf Sarahs Stimme des Widerstands zu hören? Wie stellen wir sicher, dass unser Judentum nicht nur Bewahrung, sondern auch mutige Erneuerung ist? Wenn wir unter Druck geraten, uns anzupassen, wenn Angst uns zum Schweigen verführt – erinnern wir uns daran, dass der Bund Gerechtigkeit verlangt?
Die Herausforderung der Tora ist nicht nur Abrahams Prüfung, sondern auch Sarahs: Gewalt im Namen Gottes zu verweigern, für das Leben zu sprechen und darauf zu bestehen, dass der Bund sich an tzedakah u’mishpat misst. Jede Generation muss fragen: Werden wir nur Formen erben – oder mit Gerechtigkeit handeln? Werden wir Sarah erneut zum Schweigen bringen – oder werden wir ihrer Stimme folgen?