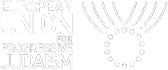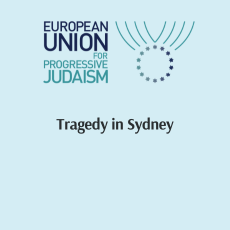B’reishit – Deutsch
Bereschit und der Mut, neu zu beginnen
Rabbinerin Lea Mühlstein (Korrektur Dr. Jan Mühlstein)
„Da sprach Gott: ‚Es werde Licht‘. So wurde Licht. Gott sah das Licht, dass gut war, und unterschied zwischen dem Licht und der Finsternis. … Gott sah alles, was er gemacht hatte, und fand es sehr gut.“ (1. Buch Mose 1:3–4, 31, nach der Übersetzung von Moses Mendelssohn)
Am Anfang der Tora entfaltet sich die Schöpfung nicht nur mit Rhythmus, sondern auch mit Zweck. Gott bringt Ordnung ins Chaos und hält inne, um zu reflektieren: das Licht ist gut, die Meere sind gut, die Erde ist gut. Doch erst am Ende des Kapitels, als der Mensch erschaffen wird, blickt Gott auf alles zusammen und findet es tov me’od – sehr gut.
Der berühmteste jüdische Kommentator Europas, Raschi (1040 – 1105), erklärt, dass dieses letzte Urteil auf den Menschen selbst zurückzuführen ist. Menschen sind fähig, sowohl Segen als auch Zerstörung zu bewirken, doch ihre Freiheit ist es, die die Schöpfung vollendet. Für Raschi ist die Welt erst dann wirklich „sehr gut“, wenn sie Geschöpfe enthält, die wählen, handeln und mit Gott zusammenarbeiten können, um das Kommende zu gestalten.
Auf dieser mittelalterlichen Einsicht aufbauend, führen moderne jüdische Denker fort, die menschliche Verantwortung zu betonen. Franz Rosenzweig (1886–1929), einer der führenden jüdischen Philosophen Deutschlands, lehrte in Der Stern der Erlösung, dass Schöpfung kein abgeschlossenes Ereignis, sondern ein fortdauernder Prozess ist. Gott beendet die Schöpfung in Bereschit nicht; sie setzt sich fort, jedes Mal, wenn Menschen Verantwortung für die Welt übernehmen. Für Rosenzweig bezeichnet tov me’od eine offene Schöpfung, die darauf wartet, dass wir uns an ihrer Vollendung beteiligen.
Rosenzweigs Vision, obwohl sie sich von der Ideologie des Reformjudentums unterscheidet, fand in einem Deutschland Resonanz, das bereits durch die Entstehung des Reformjudentums, dass sich dort als liberales Judentum bezeichnete, geprägt war. Angesichts von Emanzipation, Aufklärung und den Umwälzungen des modernen Europas stellten Pioniere wie Abraham Geiger (1810 – 1874) und Samuel Holdheim (1806 – 1860) eine parallele Frage: Was ist hier Licht? Was kann als gut gelten?
Die frühen Reformpioniere betrachteten das Erbe der jüdischen Tradition, wie man die ersten Verse der Tora betrachtet: ein Wirbel aus Licht und Schatten, Möglichkeit und Begrenzung. Sie suchten Ordnung in diesem gewaltigen Erbe, indem sie das hervorhoben, was bleibende moralische Kraft besaß, und Praktiken beiseiteließen, die das ethische und prophetische Wesen des Judentums verdunkelten. In ihren Predigten, Gebetbüchern und Institutionen beharrten sie darauf, dass das Judentum sich erneuern könne. Diese Erneuerung sollte nicht durch Verwerfung der Vergangenheit geschehen, sondern durch die Klärung ihrer tiefsten Wahrheiten – um sie als „sehr gut“ für eine neue Zeit zu benennen.
Der amerikanische reformjüdische Theologe Eugene Borowitz (1924–2016) gab diesem Impuls später eine brit-Theologie – also eine Bundestheologie. Für ihn war der Bund nicht bloß Gehorsam, sondern Dialog. Gottes Einladung an Israel ist ohne die menschliche Antwort unvollständig. Göttliche Güte wird erst dann real, wenn Menschen sie in ihren Entscheidungen verkörpern. Aufbauend auf dem intellektuellen Erbe der deutschen Reformpioniere greift Borowitz damit sowohl Raschi als auch Rosenzweig auf: Die Güte der Schöpfung – und die des Judentums – wird durch Partnerschaft verwirklicht.
Neu zu beginnen ist nie leicht. Mehr als hundert Jahre nach dem Tod der ersten Reformpioniere machte es sich eine neue Generation – unter ihnen mein Vater – zur Aufgabe, das liberale jüdische Leben in Deutschland nach der Shoah wiederzubeleben. Wie die ersten Pioniere bestand ihr Mut darin, zu beurteilen, zu bekräftigen und zu vertrauen, dass ein erneuertes Judentum als tov me’od gelten könne. Sie verkörperten den Mut, nicht nur zu bewahren, sondern zu erschaffen – als Gottes Partner, die eine jüdische Zukunft für ihre Kinder und Enkel gestalteten. Sie gründeten eine lebendige, moderne liberale jüdische Bewegung für das Deutschland des 21. Jahrhunderts.
Dieser Mut hallt weit über die Reformbewegung hinaus in unsere Zeit hinein. Die zeitgenössische orthodoxe israelische Philosophin Tamar Ross (geb. 1938) wurde stark von dieser Idee fortdauernder Schöpfung und Offenbarung beeinflusst. In ihrem Werk Expanding the Palace of Torah („Den Palast der Tora erweitern“) argumentiert Ross, dass Offenbarung kumulativ ist: Jede Generation erweitert die Bedeutung der Tora, indem sie neue Stimmen und Einsichten hinzufügt. Was im 19. Jahrhundert in Deutschland einst radikal war, ist heute Teil des jüdischen Mainstreams: die Überzeugung, dass Gottes Bund nicht in der Vergangenheit eingefroren ist, sondern sich durch menschliche Teilhabe entfaltet.
Mit Bereschit gelesen, wirkt Ross’ Lehre besonders eindrucksvoll. Gott nennt die Schöpfung sehr gut nicht, weil sie vollendet wäre, sondern weil sie uns anvertraut wurde. Die Aufgabe der Menschheit in jeder Generation ist es, das Versprechen der Schöpfung zu erweitern – in unserer Zeit neu zu beginnen.
Wenn wir also in diesem Jahr zu Bereschit zurückkehren: Was müssen wir als Licht benennen? Wo müssen wir Dunkelheit von Güte trennen – im jüdischen Leben und in der Welt? Wie werden wir bekräftigen, was für unsere Gemeinschaften heute tov me’od ist?
Das erste Kapitel der Tora ist nicht nur Erinnerung an die Geburt der Welt, sondern ein Auftrag an jede Generation. Die Schöpfung als sehr gut zu sehen heißt, den Mut zur Partnerschaft anzunehmen. Das Reformjudentum wurde aus diesem Mut in Deutschland geboren, vor fast zwei Jahrhunderten. Unsere Aufgabe ist es, diesen Mut fortzuführen: zu schaffen, zu unterscheiden und neu zu beginnen, damit in unserer Zeit die Welt als tov me’od – sehr gut – bezeichnet werden kann.